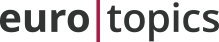Die Medienberichterstattung der vergangenen Jahre war im Vereinigten Königreich von der Corona-Pandemie, den Partys in Downing Street zu Zeiten von Ausgangssperren und den folgenden Regierungswechseln dominiert. Der “Partygate”-Skandal schadete nicht nur dem Vertrauen in die Politik. Die mitunter atemlose und polarisierte Berichterstattung entfremdete viele Mediennutzer.