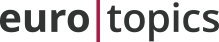Das Wahljahr 2023 war auch für die Medien mit großen Hoffnungen verbunden. Von einem Sieg der Opposition erhoffte man sich mehr Freiheiten. Doch es kam anders, der Druck auf den unabhängigen Journalismus dürfte bis auf Weiteres nicht nachlassen. Ein neues "Desinformationsgesetz" ist dafür ein weiteres Beispiel.