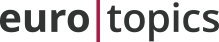Italien zahlt: Ist die Bankenunion hinfällig?
Die Regierung in Rom stellt 17 Milliarden Euro für die Rettung zweier maroder Regionalbanken zur Verfügung. Die EU-Kommission gab grünes Licht, da die Gläubiger an den Kosten beteiligt werden. Die Tatsache, dass die Banken dennoch nur mit Steuergeldern in Milliardenhöhe gerettet werden konnten, wirft für Kommentatoren die Frage auf, ob die Bankenunion der EU überhaupt funktioniert.
Und wieder blecht der Steuerzahler
Italiens Rettungsaktion macht die EU-Bankenunion zur Farce, analysiert Der Standard:
„Die Hilfsaktionen stoßen sauer auf, weil die EU den Bürgern längst weisgemacht hat, dass keine öffentlichen Mittel mehr in darniederliegende Kreditinstitute fließen werden. Das dazu errichtete Netz schien vorhanden: Erstens sollten Aktionäre und Gläubiger ... einen Beitrag leisten und Anteile und Forderungen abschreiben. Wenn das immer noch nicht reicht, stünden zweitens die Abwicklungsfonds zur Verfügung, die von den Banken finanziert werden. Immer wieder finden Nationalstaaten, EU-Kommission und Aufsicht Argumente, warum das neue Regelwerk im aktuellen Fall gerade nicht angewendet werden muss. Da wäre es nur ehrlich, das ganze Werk gleich abzureißen.“
Brüssel sollte Regeln überdenken
Rom Vorwürfe wegen der Bankenrettung zu machen, ist für den Ökonomen Francesco Giavazzi unsinnig. Er schreibt in Corriere della Sera:
„In nur sechs Monaten ist es der Regierung gelungen, die dunkle Wolke zu vertreiben, die seit Jahren über Italien schwebte. ... Die EU-Regeln waren dabei wenig hilfreich, woraus man schließen darf, dass diese zumindest zum Teil korrigiert werden müssen. … Rechnet man zu der gestrigen staatlichen Finanzspritze (in Höhe von fünf Milliarden Euro) die fünf Milliarden Euro hinzu, die nötig waren, um Monte dei Paschi zu retten, handelt es sich um lächerliche Summen verglichen mit den 140 Milliarden Euro, die Berlin ausgegeben hat, um seine Banken zu stabilisieren. Doch intelligenter als wir griff Berlin ein, als die EU-Regeln die Rettung mit Hilfe von Steuergeldern noch gestatteten. Folglich regte sich niemand darüber auf.“
Rettung kommt zu spät
Dass Rom nun keine andere Wahl hatte, als die Banken zu retten, haben sich die Regierenden selbst zuzuschreiben, findet La Repubblica:
„Sowohl die jetzige als auch die vorherige Regierung wollten sich das Ausmaß der Bankenkrise nicht eingestehen. Zu Beginn der Krise 2016 wurden über den Bankenrettungsfonds Atlante vier Milliarden Euro von Banken, Bankstiftungen und Versicherungen eingesammelt. Mit dem Geld hätten die faulen Kredite aufgekauft werden sollen, stattdessen wurde es als frisches Kapital in die beiden Banken gepumpt, erfolglos. Es hätte weit mehr bedurft, auch staatlicher Hilfen, allerdings hätte man dafür Brüssel offen herausfordern müssen. ... Und das Verfassungsreferendum stand an und staatliche Hilfen für Banken wären keine gute Werbung für die Regierung gewesen. ... Jetzt bleibt Rom nur mehr, die Scherben aufzusammeln und zu kitten.“
Bankenunion braucht bessere Regeln
Die Staatshilfe Roms verstößt gegen die Regeln der Bankenunion, klagt De Tijd:
„Die italienische Regierung versucht damit, eine finanzielle und politische Krise zu verhindern. Aber sie muss ziemlich viel Staatsgeld einsetzen. Jetzt, wo die Regeln der Europäischen Bankenunion in der Praxis erprobt werden müssen, ist das offensichtlich nicht so einfach. Das Drehbuch, das Europa für die Abwicklung von Problembanken entwickelt hat, ist nicht überall brauchbar. ... Denn der italienische Staat muss doch erneut tief in die Tasche greifen. Es bleibt abzuwarten, wie die Finanzmärkte darauf reagieren und wie die Auswirkungen auf den italienischen Staatszins aussehen werden. Aber was nun geschieht, macht deutlich, dass die Absprachen über die europäische Bankenunion und die Abwicklung der Problembanken deutlich korrigiert werden müssen.“