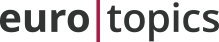Kreditgeber machen Athen letztes Angebot
Die internationalen Geldgeber Griechenlands haben Premier Alexis Tsipras ein "letztes Angebot" zugestellt, berichten Medien nach einem Treffen am Montagabend in Berlin. Es soll einen Kompromiss über die Bedingung weiterer Hilfszahlungen enthalten. Endlich tritt Athen als selbstbewusster Verhandlungspartner auf, loben einige Kommentatoren. Andere hoffen, dass mit dem Vorschlag ein Grexit vorerst abgewendet ist.
Athen wird sich nicht unterwerfen
Dass die Gespräche im Kanzleramt bis spät in die Nacht dauerten, ist für das linksliberale Onlineportal To Vima ein erfreuliches Zeichen: "Was in den letzten Tagen zwischen Athen und den Gläubigern passiert ist, ist ungewöhnlich. Denn es ist das erste Mal seit 2010, dass die griechische Seite das tut, was vorher nie getan wurde: wirklich zu verhandeln. ... Dies zeigen die schlaflosen Nächte im Bundeskanzleramt und die Tatsache, dass es noch keine Bewegung in den Gesprächen gibt. ... Und dies ist das wichtigste Anzeichen dafür, dass die griechische Seite sich erheblich anstrengt. ... Denn wenn es eine Bewegung gäbe, würde es nur eines bedeuten: die vollständige Unterwerfung unter die Bedingungen der Kreditgeber."
Grexit käme Europa teuer zu stehen
Die griechische Staatspleite muss um jeden Preis verhindert werden, meint die liberale Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore und begrüßt den Versuch der Geldgeber, Athen ein "letztes Angebot" zu machen: "Die Europäer sollten sich überlegen, was es bedeutet, vom Grexit zu reden. Viele Experten behaupten, dass Europa heute besser gerüstet ist gegen eine mögliche Ansteckungsgefahr. Doch statt an Meinungen sollten wir uns an Zahlen halten. Bei einer Insolvenz Griechenlands stünden insgesamt 600 Milliarden Euro auf dem Spiel. Dagegen war die Pleite von Lehman Brothers ein Klacks. Vielleicht wäre es für alle besser, über die verheerenden sozialen Folgen und die Wunden in der europäischen Konstruktion nachzudenken, die der mögliche Austritt hinterlassen würde. Der Ausgang der Verhandlungen ist ungewiss, doch eine Gewissheit haben wir: Die Pleite Griechenlands dürfte einer Wiederbelebung der europäischen Wirtschaft nicht zuträglich sein."
Kleine Euro-Staaten müssen mitverhandeln
Bei der Lösung der Griechenlandkrise müssen die kleinen Staaten ernster genommen werden, fordert die liberal-konservative Neue Zürcher Zeitung. In Ländern wie Slowenien sei der Anteil der Griechenlandhilfen am Bruttoinlandsprodukt weit höher als etwa in Deutschland: "Dennoch sucht Athen das Gespräch vor allem mit den aus absoluter Sicht grossen Geldgebern wie Deutschland oder Frankreich, etwa im Rahmen sogenannter Mini-Gipfel. Für Staaten wie Slowenien sind solche Sololäufe ein demokratiepolitischer Affront. ... Die Verantwortlichen der Eurozone tun gut daran, das Unbehagen der kleineren Mitgliedsländer ernst zu nehmen. Im engen Kreis mit Athen einen Deal auszuhandeln und dann die weniger gewichtigen Euro-Staaten vor vollendete Tatsachen zu stellen, erscheint als gefährliche Strategie. So herrscht in der Währungsunion das Konsensprinzip. Dass man auf diesem Prinzip durchaus zu beharren weiss, verdeutlichte bereits 2011 die Slowakei, die damals den Umbau des Euro-Krisenfonds EFSF beinahe zu Fall brachte. Man ist also vorgewarnt."