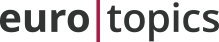Was sind die Lehren aus dem Georgienkrieg 2008?
Die Frage, wer die Schuld am Ausbruch des Kriegs um Südossetien zwischen Georgien und Russland im August 2008 trägt, ist bis heute umstritten. Die Region hatte schon länger nach Autonomie gestrebt. Moskau missfiel die Annäherung Georgiens an EU und Nato. Seit den fünftägigen Kämpfen gilt der Konflikt als eingefroren. Sowohl der Westen als auch Russland hätten aus dem Krieg lernen müssen, finden Journalisten.
Da war es mit der Ruhe vorbei
Der Krieg zwischen Russland und Georgien hat dem Westen eine wichtige Lektion erteilt, meint Upsala Nya Tidning:
„Medwedew, der während des Georgienkriegs Präsident [Russlands] war, meint, dass es von der Nato verantwortungslos war, Georgien die Mitgliedschaft anzubieten. Georgien seine eigenen sicherheitspolitischen Entscheidungen zu treffen zu lassen, scheint für Russland undenkbar zu sein. Durch die Unterstützung prorussischer Politiker und NGOs, Cyberattacken und andere Aktionen versucht der Kreml, das gesellschaftliche Klima in Georgien zu beeinflussen. ... Russland agiert ähnlich in anderen Teilen Europas. Nach dem Kalten Krieg haben viele geglaubt, dass der Frieden in Europa gesichert sei. Am 8. August 2008 haben wir umdenken müssen. Das Selbstbestimmungsrecht demokratischer Staaten darf nicht als gegeben betrachtet werden und muss immer verteidigt werden.“
Krim-Annexion kam nicht aus heiterem Himmel
Der Westen hat Russland 2008 noch vollkommen unterschätzt, findet Rzeczpospolita:
„Vor zehn Jahren hat Russland in Georgien dem Westen gezeigt, dass es Krieg als legitimes Instrument zur Realisierung seiner neo-imperialistischen Politik versteht. Aber der Westen wollte das nicht zur Kenntnis nehmen. Aus dem Krieg, in den der Kreml das kleine kaukasische Land gezogen hat, hat der Westen nichts gelernt. Und dann, im Jahr 2014, hat er verwundert zugeschaut, wie die Russen die Ukraine angriffen - ein deutlich größeres Land mit Grenzen zu Mitgliedsländern von EU und Nato. Diesen späteren Krieg musste der Westen dann zur Kenntnis nehmen.“
Kampf zweier Systeme
Südossetien ist damals nicht zufällig zu einem eingefrorenen Konflikt geworden, erklärt die Süddeutsche Zeitung:
„Die Rosenrevolution fünf Jahre zuvor, die Demokratisierung und klare Orientierung [Georgiens] gen Westen hin zur Nato verstärkten die Einkreisungsängste Moskaus und vor allem die Furcht vor der demokratischen Infizierung. ... [D]ie frozen conflicts in Russlands Nachbarschaft [werden sich] nicht durch einen Willensakt der politischen Führung lösen lassen. Nötig ist es vielmehr, Russland seine Einkreisungsängste zu nehmen - Einkreisungsängste, die aber auch vorgeschoben erscheinen, um das eigentliche Motiv für diese kalte Machtpolitik zu verschleiern. Russlands Grenze ist nämlich auch die Grenze zwischen konkurrierenden politischen Systemen. Putins Vertikale der Macht und die Idee des Machtausgleichs à la EU vertragen sich nicht.“
Moskau in politischer Sackgasse
Militärisch gesehen errang Russland in dem Fünf-Tage-Krieg zwar den Sieg, doch politisch brachte er keinen Gewinn, analysiert Vedomosti:
„Das wesentliche Ergebnis des Kriegs war, dass die Wiederherstellung der territorialen Integrität Georgiens endgültig unmöglich und der besondere Status Südossetiens und Abchasiens bekräftigt wurde. Moskau, das die Unabhängigkeit beider Republiken am 26. August 2008 anerkannte, brachte sich damit in eine schwierige Lage. Seither kann es sich nicht mehr ohne Gesichtsverlust an einer Lösung des Konflikts zwischen Georgien und seinen ehemaligen Autonomiegebieten beteiligen. ... Die Bestätigung der Unabhängigkeit brachte Russland nur wenig Dividenden: Seinem Beispiel folgten nur Einzelstaaten. ... Selbst die engsten Verbündeten - Belarus und Kasachstan - zogen es vor, von einer Anerkennung Abstand zu nehmen.“