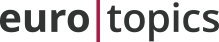Schottland: Nicola Sturgeon tritt zurück
Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon, im Amt seit 2014, hat ihren Rücktritt angekündigt. Sturgeon und ihre Partei - die Scottish National Party SNP - waren zuletzt vermehrt in Kritik geraten. Unter anderem, weil es mit ihrem Fernziel, der Unabhängigkeit Schottlands, nicht voranging. Europas Presse diskutiert die Auswirkungen des Rücktritts.
Die Unabhängigkeitsgegner freuen sich
Eine schottische Unabhängigkeit dürfte nach Sturgeons Abgang unwahrscheinlicher werden, analysiert Dnevnik:
„Die [in London] regierenden Rechtskonservativen, die in Schottland schon immer politische Pygmäen waren, sowie die oppositionelle Labour Party, die viele Jahre die führende politische Kraft in Schottland war, freuen sich - eher leise als laut - über ihren Abgang. Beide sind gegen die Unabhängigkeit Schottlands und glauben, dass der Abgang von Nicola Sturgeon diese bremst. Sie haben wahrscheinlich Recht. Viel hängt davon ab, wer ihr nachfolgt und ob der Nachfolger es wagt, wie von Sturgeon beabsichtigt, die nächste schottische Wahl zum Referendum über die Unabhängigkeit zu erklären.“
Verfechterin eines schädlichen Traums
Es ist gut, dass Nicola Sturgeons Ziel der Unabhängigkeit bislang scheiterte, meint NRC:
„Sturgeon setzte sich erfolgreich ab gegenüber Boris Johnson, Nigel Farage und anderen Brexiteers, die eine konträre Art des Nationalismus predigten. Dennoch sind Sturgeon und die populistischen Brexiteers keine totalen Gegenpole. Sie verherrlichen alle eine Art der Unabhängigkeit, ohne einen realistischen Blick für die Nachteile zu haben. Dass der Brexit nur Verlierer kennt, ist inzwischen deutlich. ... Das Sprengen der Acts of Union von 1707, die Schottland und England miteinander verbanden, ist genauso schädlich. ... Wie gerne Sturgeon auch über Unabhängigkeit sprach, sie konnte keine Sicherheit geben, dass dies ohne Schaden geregelt werden könnte.“
Loslösung bleibt auf der Tagesordnung
Der Kampf um die schottische Unabhängigkeit wird weitergehen, glaubt The Irish Times:
„Unabhängigkeit ist das entscheidende Thema der schottischen Politik und wird es wahrscheinlich auch bleiben – ganz ungeachtet davon, wer in der SNP das Zepter übernimmt. Das separatistische Empfinden verebbt nicht. ... Unionisten mögen das Ende eines gefürchteten Feindes feiern, aber ein Zustand, in dem etwa die Hälfte der Schotten die Unabhängigkeit möchte, zu der die Demokratie ihnen aber jedes Mittel verweigert, ist auf Dauer nicht haltbar. ... Es mag ein guter Tag für Unionisten sein. Dennoch wäre es töricht, wenn sich diejenigen, die sich für den Erhalt des Vereinigten Königreichs einsetzen, nun ausruhen und glauben, dass ihr Kampf gewonnen sei.“
Schwer zu füllende Fußstapfen
Es wird nicht leicht werden, eine würdige Nachfolge für Sturgeon zu finden, meint The Scotsman:
„Sie wird nicht zuletzt für ihre Führung durch die Covid-Pandemie im nationalen Gedächtnis bleiben. Hier zeichnete sie sich als ruhige und empathische Kommunikatorin aus, die die Sorgen ihres Volkes mildern konnte und damit neidische Blicke von Wählern aus dem Rest des Vereinigten Königreichs und von weiter weg anzog. Sie wird außerdem als eine kraftvolle Vorkämpferin ihrer SNP in Erinnerung bleiben. Ihre kommunikativen Fähigkeiten nutzte sie, um einen rationalen, ernsthaften und intellektuell selbstbewussten, bürgerschaftlichen Nationalismus zu zeigen, der es der Bewegung ermöglichte, den unangenehmen Fragen nach Überlegenheit, Egoismus und sektiererischer Spaltung, die vielen anderen nationalistischen Bewegungen gestellt wurden, weitgehend auszuweichen.“
Sie hat viel erreicht
Auch der Tagesspiegel würdigt Sturgeons Leistungen:
„Nach dem Brexit-Referendum 2016 war sie die erste und lange Zeit einzige, die – bei allem Respekt vor der Mehrheit – jenen 48 Prozent der Briten (und 62 Prozent der Schotten) Mut zusprach, die weiterhin zur EU gehören wollten. In der Covid-Pandemie bildeten ihre täglichen Auftritte einen wohltuenden Kontrast zum Londoner Tohuwabohu unter dem damaligen Premier Boris Johnson. Fünf konservativen Premiers hat Sturgeon das Leben schwer gemacht, hat zäh um Zugeständnisse für ihre Nation gekämpft, immer wieder viel Geld in London lockergemacht. Die SNP eilte unter ihrer Führung von Wahlsieg zu Wahlsieg. ... Gewiss hätte sie noch jahrelang mehr oder weniger unangefochten weitermachen können.“
Brutalität fordert ihren Tribut
Frauen klammern sich eben nicht an die Macht wie Männer, lobt La Stampa:
„Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern hat ein neues Modell eingeführt: Frauen, die zurücktreten. Rücktritt - ein fast unbekanntes Wort auf dem Politikplaneten der Männer, es sei denn, er ist auferlegt oder unmöglich zu vermeiden und widerwillig akzeptiert. ... Die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon hingegen hat kein Problem damit, zu sagen, sie sei nicht nur Politikerin, sondern auch ein Mensch. Und dass die Brutalität der modernen Politik ihren Tribut fordere von den Politikern und ihrem Umfeld.“
Eine Geschichte des Scheiterns
Die Lobeshymnen auf Nicola Sturgeon sind fehl am Platze, findet The Times:
„Durch ihre eigenen Fehler gezwungen, hat Sturgeon nun hastig eine steuerlose Regierung zurückgelassen, eine Partei ohne Plan und ein Volk, das von beiden kläglich im Stich gelassen wurde. Erste Ministerin für acht Jahre, Stellvertreterin für sieben – niemand hat so lange auf den Kommandohöhen schottischer Politik zugebracht wie Sturgeon. ... Die Gründe des Rücktritts der Ersten Ministerin sind wesentlich prosaischer, als die von ihr gestern gewandt dargestellte Geschichte persönlicher Qualen. Es ist nämlich eine Geschichte von Hybris, Fehleinschätzungen und Scheitern.“
Kapitulation vor der Polarisierung
Sturgeon beschreibt in ihrer Begründung vor allem das vergiftete politische Klima in Großbritannien, beobachtet Polityka:
„Der Hauptgrund für den Rücktritt scheint die Ermüdung zu sein, nicht nur mit dem Amt, sondern mit dem allgemeinen Zustand der britischen politischen Landschaft. Es herrsche ein Klima, das der Polarisierung Vorschub leiste, während die Priorität der einzelnen Parteien darin bestehen sollte, für bessere Lebensbedingungen der Bürger zu sorgen. Sie beklagt, dass immer mehr Menschen sie eher durch das Prisma persönlicher Sympathien oder Antipathien als mit Blick auf tatsächliche Entscheidungen sähen.“