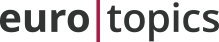Zehn Jahre Finanzkrise - was haben wir gelernt?
Anfang August 2007 platzte die US-Immobilienblase und brachte die Banken weltweit in Bedrängnis. Im Jahr darauf erreichte die Finanzkrise mit der Insolvenz von Lehman Brothers ihren Höhepunkt. Kommentatoren sind skeptisch, ob die Welt die richtigen Lehren gezogen hat.
Das neue Risiko sind die IT-Giganten
Wie vor der Finanzkrise liegt auch heute zu viel Einfluss in den Händen einiger weniger, kritisiert The Times:
„Damals waren es die Banker. Heute sind es Google, Facebook und ein paar andere, die zu mächtig sind und vielleicht aus Versehen den Zusammenbruch unserer Wirtschaft herbeiführen können. Uns steht eine andere Art von Krise bevor. Irgendwann werden wir uns entscheiden müssen, wie wir diese Riesen bändigen, wie wir sie zerschlagen und sicherstellen, dass sie sich an Regeln halten, die von demokratischen Regierungen in unserem Auftrag festgelegt wurden. Nur so können wir garantieren, dass wir die Technologie beherrschen und nicht die Technologie sowie deren Eigner uns beherrschen.“
Banken lassen Niederlande zum Glück links liegen
Zehn Jahre nach der Bankenkrise wird die Royal Bank of Scotland im Zuge des Brexit wieder in die Niederlande kommen. Das ist zum Glück eine Ausnahme, meint NRC Handelsblad:
„Eine Lektion der Krise von damals ist, dass ein großer Finanzsektor längst nicht immer ein Segen ist. Wenn die Wirtschaft zu abhängig ist von Geld- und Kapitalgeschäften, dann bekommt sie auch den größten Schock, wenn es dort schief läuft. ... Ja, es wurden deutliche Fortschritte gemacht bei der Kontrolle des Finanzsektors. ... Aber wie so oft bei Regulierungen und Aufsichtsmechanismen hinken diese der Praxis, der Innovation und den Dimensionen hinterher. ... Die Niederlande haben mit ihren strengen Bonusregeln für die Niederlassung finanzieller Institute an Attraktivität eingebüßt. Zum Jahrestag der Krise stellt sich die Frage, ob man das sehr bedauern muss.“
Kein Konjunkturtief dauert ein Jahrzehnt
Um die Folgen der Krise zu bewältigen, braucht es Veränderungen im System, bilanziert El Periódico de Catalunya:
„Die Dominosteine kippten einer nach dem anderen und rissen dabei Banken, Sparkassen, den Bausektor des halben Planeten und schließlich an der Schuldenlast erstickte Länder mit sich. ... Die außergewöhnlichen Hilfsmaßnahmen konnten zwar die Blutung stillen, nicht aber den Wohlstand und die Sicherheit von vor zehn Jahren zurückbringen. Eine zehn Jahre andauernde Krise ist mehr als nur ein konjunkturbedingtes Tief. ... [Für viele Krisenopfer] bedeutet sie keinen Ausnahmezustand, sondern sie ist zum normalen Alltag geworden. Sie hoffen nicht auf den Aufschwung, sondern auf einen Wandel im System.“
Von Einsicht keine Spur
Zehn Jahre später haben weder Regierungen noch Finanzwelt wirklich etwas gelernt, fürchtet Jyllands-Posten:
„Die Topchefs der Großbanken der Wall Street erhalten wieder Jahresgehälter in dreistelliger Millionenhöhe. ... In Europa liegt die Arbeitslosigkeit immer noch über der von vor zehn Jahren, und in vielen europäischen Ländern ist die Jugendarbeitslosigkeit weiterhin erschreckend hoch. ... Viele dringend benötigte politisch-wirtschaftlichen Reformen wurden zu leeren Versprechen, zum Beispiel in Italien und Frankreich. ... Wir können uns über Wirtschaftswachstum freuen, und die Reaktionsmöglichkeiten auf Krisen wurden verbessert. Aber mit unrealistisch hohen Aktienkursen kann die nächste Krise bereits auf dem Weg sein - noch bevor die Rechnungen der vorangehenden bezahlt sind.“
Aus Gier die Grenzen nicht gesehen
An die Ursachen der Krise erinnert Corriere del Ticino:
„Vor zehn Jahren schien die Globalisierung ein Phänomen, dem keine Grenzen gesetzt sind. Teil davon waren die neuen Finanzmittel, die mit exotischen Namen das Risiko des Käufers verschleierten. In dem unendlichen Netz der Verbriefungen verschwand der eigentliche Schuldner. Das Ende der Trennung zwischen Kredit- und Investmentbank ermunterte zu den waghalsigsten Operationen. ... Die große Liquidität und die niedrigen Zinsen eröffneten, in den Augen der Finanzdealer, unendliche Weiten für den Gewinn. Doch wächst das Geld nicht auf Bäumen, weder damals noch heute. Auch nicht dank noch so ausgeklügelter Algorithmen.“
Ein Jahrzehnt voller Fehler
Die groben politischen Schnitzer bei der Überwindung der Finanzkrise analysieren die Wirtschaftsexperten Alberto Alesina und Francesco Giavazzi in Corriere della Sera:
„Die Antwort der Regierung Obama auf die Krise wäre weitaus effizienter ausgefallen, wenn sie statt auf große Infrastrukturprojekte auf eine entschlossenere Steuersenkung gesetzt hätte. In Europa hätte der Sparkurs weitaus weniger gekostet, wenn man sich auf Kürzungen im Haushalt konzentriert hätte, wie in Irland und in Großbritannien, statt auf die Anhebung des Steuerdrucks, wie in Italien in den Jahren 2011-2012. Ganz abgesehen von der Langsamkeit, mit der Länder wie Italien begriffen haben, dass eine Stabilisierung der Banken vonnöten war. Zu guter Letzt hätte man sofort die Insolvenz Griechenlands akzeptieren müssen, statt eine konfuse Farce über Jahre fortzusetzen mit dem einzigen Ziel, den deutschen und französischen Banken zu helfen.“
Finanzlobby setzt sich noch immer durch
An die Lehren aus der Finanzkrise will sich im politischen Europa niemand mehr erinnern, klagt Le Soir:
„Die verschärften Überwachungsregeln [für Banken] werden nunmehr in Frage gestellt, da angeblich die Gefahr besteht, dass sie die Kreditvergabe bremsen und unsere 'Champions' (also die französischen und deutschen Großbanken) gegenüber ihren außereuropäischen Wettbewerbern benachteiligen. Schlimmer noch: Die Kommission will Verbriefungen neu beleben - jene Technik, die es den Banken erlaubt, Kredite (und somit Risiken) an andere Investoren weiterzureichen, und die zur weltweiten Verbreitung der faulen Subprime-Kredite aus dem US-Hypothekengeschäft beitrug. Als ob uns die Krise nicht gelehrt hätte, dass das, was für große Finanzinstitute gut ist, nicht unbedingt auch unserer Wirtschaft nutzt.“
Unten kommt nicht genug Geld an
Der Aufschwung steht noch auf keinem stabilen Fundament, erinnert La Vanguardia:
„Das aktuelle Wachstum stützt sich auf eine exzessive öffentliche und private Verschuldung, die das Dauerrisiko eines Rückfalls in die Krise birgt. Aber die Welt hat sich zumindest vorläufig an den Tanz auf diesem Vulkan gewöhnt. ... Das bislang ungelöste Problem besteht darin, dass die Wirtschaft mit den riesigen, fast kostenlos ausgegebenen Geldmengen viel stärker wachsen und viel mehr Arbeitsplätze schaffen müsste, als sie es zurzeit tut. Gleichzeitig müsste man sich in Richtung einer stärkeren Umverteilung des Wohlstands bewegen, um die wachsende Ungleichheit zu bekämpfen. Ein Ziel, bei dem die Welt, einschließlich Spanien, nicht vorwärtskommt.“