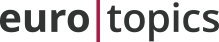Gipfel in Paris: Wie KI zugleich zähmen und fördern?
In Paris findet Anfang nächster Woche unter Leitung Frankreichs und Indiens ein "Aktionsgipfel zur Künstlichen Intelligenz" statt. Dabei sollen gemeinsame wissenschaftliche Grundlagen, Lösungen und Standards für eine dem Fortschritt und Gemeinwohl dienende KI erarbeitet werden. Europas Medien skizzieren, wo es angesichts der rasanten Entwicklung auf diesem Feld Spannungslinien und Defizite gibt.
Wer zuerst kommt, profitiert
Europa sollte mehr in KI investieren, rät Xavier Jaravel, Professor an der London School of Economics, in Les Echos:
„Die KI-Revolution wird am besten von denjenigen Unternehmen und Ländern gemeistert, denen es gelingt, diese Technologien am schnellsten einzuführen. So steigern sie ihre Marktanteile und schützen die Arbeitsplätze. Das Hauptrisiko besteht also nicht darin, von der KI 'ersetzt' zu werden, sondern vielmehr durch einen Konkurrenten, der die KI im selben Land oder im Ausland einsetzt. Europäische Unternehmen geben jedoch nur knapp 50 Prozent der Beträge aus, die US-amerikanische Unternehmen in die Einführung von KI investieren. Ohne eine beschleunigte Verbreitung von KI in Europa wird sich das Produktivitätsgefälle gegenüber den USA weiter vergrößern.“
Besser mehr hinterfragen
Angela Müller, Geschäftsleiterin der NGO Algorithm Watch Schweiz, fordert in einem Gastkommentar für den Tages-Anzeiger ein kritischeres Herangehen gegenüber den großen Techkonzernen:
„Solange wir ihre monopolisierte Technologie und ihre Erzählung, dass wir den ökologischen, sozialen und ökonomischen Preis von immer grösseren KI-Modellen zugunsten eines ungewissen Nutzens in der Zukunft akzeptieren müssen, unhinterfragt übernehmen, wird KI vor allem ihrem illustren Kreis, nicht aber der Menschheit und dem Planeten als Ganzes dienen. … Das Potenzial der Technologie nutzen wir nur dann wirklich, wenn wir ihre Herausforderungen ernsthaft angehen. Dazu gehört auch, den ökologischen Fussabdruck und die Machtkonzentration hinter grossen KI-Modellen in den Fokus zu rücken und so ein innovatives, nachhaltiges und gemeinwohlorientiertes KI-Ökosystem zu ermöglichen.“
Nachhaltiger Kurswechsel vonnöten
Die französische Botschafterin in der Schweiz und Liechtenstein, Marion Paradas, erläutert in La Tribune de Genève die Herausforderungen durch KI auf internationaler Ebene:
„Zunächst muss der Zugang zu KI für möglichst viele Menschen gewährleistet werden. … Dann muss die KI ihren vollen Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel leisten. Aktuell verfolgt sie jedoch einen energetisch nicht haltbaren Kurs. Als Reaktion darauf soll eine internationale Allianz aus verschiedenen Akteuren für nachhaltige KI ins Leben gerufen werden, um die Forschung zu den Umweltkosten der KI zu vertiefen, neue Standards zu definieren und die grünen Investitionen zu erhöhen. Schließlich sollten wir gemeinsam ein effizientes und inklusives KI-Governance-System aufbauen.“
Ergänzung oder Ersatz unserer Gehirne?
Die Debatte über den Einsatz von KI in der Wirtschaft hat zwei Lager hervorgebracht, erklärt Corriere della Sera:
„Auf der einen Seite steht das konservative Lager, das argumentiert, dass die KI langfristig die menschliche Arbeitskraft ersetzen wird. Diese Partei stützt sich auf die historische Sichtweise, die seit dem Luddismus [Maschinensturm] die Technologie als Hindernis für die volle Entfaltung des Menschen in seinen sozialen und beruflichen Aktivitäten betrachtet. ... Neben dieser pessimistischen Interpretation der Technik gibt es ein modernistisches Lager. Ein Lager, das sich zwar der ethisch-politischen Implikationen der künstlichen Intelligenz bewusst ist, aber dazu neigt, sie aus einer evolutionistischen Perspektive zu interpretieren.“
Urheberrechte nicht verschenken
Ein aktuelles Beispiel für einen KI-Konflikt kommt aus Estland: Das Ministerium für Justiz und Digitales hat angekündigt, die Inhalte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und weiterer Medien kostenfrei der Sprach-KI von Meta zur Verfügung zu stellen, damit diese ihr Estnisch trainieren kann. Mari-Liis Rüütsalu, Vorstand der Ekspress Mediengruppe, hält dies in ERR Online für den falschen Weg:
„Erstens: Journalistische Inhalte sind geistiges Eigentum, das durch das Urheberrecht geschützt ist. Die Tatsache, dass der ERR-Content mit Steuergeldern erstellt wird, bedeutet nicht, dass er kostenlos an gewinnorientierte Technologieriesen verschenkt werden kann. ... Zweitens sendet der estnische Staat damit in einer Zeit, in der es in den USA und anderen Ländern Klagen wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen durch KI-Unternehmen gibt, ein gegenteiliges Signal.“