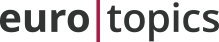US-Politik: Wie sollte Europa sich wappnen?
US-Zölle gegen die EU, Ansprüche auf Grönland, verächtliche Bemerkungen von hochrangigen US-Regierungsmitgliedern im Signal-Chat – der Ton zwischen Washington und Brüssel wird rauer. Kommentatoren fragen sich, worauf Europa nun setzen sollte und ob massive Aufrüstung die richtige Antwort ist.
Russland ist nicht mehr die größte Gefahr
Rafael Vilasanjuan definiert in El Periódico de Catalunya neue Fronten für Europa:
„Russland wird kaum die gesamte Union unterwerfen. Polen und das Baltikum sind sehr verlockend, aber wenn Moskau es in drei Jahren kaum geschafft hat, die militärisch unterlegene Ukraine zu besiegen, ist eine Bedrohung der EU unrealistisch. ... Der eigentliche Krieg ist nicht militärisch, sondern kommerziell, wirtschaftlich und strategisch. Und hier müssen wir angreifen: in Technologie, in einen globalen Wissensraum, in einen kommerziell offenen und mächtigen Kontinent investieren. Denn der Hauptfeind ist nicht mehr Russland, sondern die USA.“
Zwischen Unabhängigkeit und Opportunismus
Europa kann nicht völlig unabhängig von den anderen Weltmächten werden, doch auch bei der Struktur seiner Abhängigkeit gilt es Abwägungen zu treffen, erklärt der Politiker Tommaso Nannicini in La Stampa:
„Es geht darum zu entscheiden, ob man eine multiple Zweckdienlichkeit anstrebt, indem man sich mit verschiedenen Mächten verbündet – je nach Bereich, von der Verteidigung bis zur Energie, von der Technologie bis zum Handel – oder einen strategischen Einzel-Opportunismus, indem man sich unter den Schutz einer einzigen Macht stellt ... Die politischen Kräfte täten gut daran, nicht vor dem Dilemma zwischen Unabhängigkeit und größtmöglichem Vorteil zurückzuschrecken, das die neue politische Gratwanderung unserer Zeit bildet.“
Jetzt kühlen Kopf bewahren
Eine Mentalitätsveränderung ist nötig – aber ohne zu übertreiben, mahnt De Standaard:
„Eine erhöhte Alarmbereitschaft wird das neue Leitmotiv. Die Europäer müssen ihre Widerstandskraft erhöhen. 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges erfordert das eine deutliche Mentalitätsveränderung. Dennoch muss man auch einen kühlen Kopf bewahren. Es hat wenig Sinn, dem durchschnittlichen Europäer jeden Tag eine Portion Angst zu verpassen. Das bringt die Einzigartigkeit dieser Region in Gefahr. Der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt wies darauf schon vor 100 Jahren hin: 'Das einzige, das wir fürchten müssen, ist die Furcht selbst.'“
Wandel schon längst überfällig
Trump bietet eine Chance für einen längst notwendigen Umbau Europas, meint Élet és Irodalom:
„Beide Wangen Europas sind rot von Trumps Ohrfeigen und von den Demütigungen. ... Europa ist gezwungen, aufzurüsten und wird wahrscheinlich den US-Zollkrieg nutzen müssen, um neue Märkte zu erobern. Europa ist schon seit einiger Zeit reif für einen Wandel, und damit sind vor allem das überholte Entscheidungssystem der EU und ihre unmöglich schwache Verteidigungsposition gemeint. Die Hauptquelle der Stärke, aber auch der Schwäche Europas, ist die strikte Einhaltung der hart erarbeiteten gemeinsamen Regeln, die Beibehaltung des Vetorechts in einem höflichen Umfeld. ... Es braucht eine Reihe von politischen Innovationen, und wenn Europa die durchführt, kann es zu einem globalen Kraftzentrum werden.“
Wähler haben ein Mitspracherecht
Die Aufrüstungspolitik muss von den Gesellschaften Europas legitimiert werden, meint Efimerida ton Syntakton:
„Werden die Völker gefragt? Haben sie ein Mitspracherecht? Sind ihnen Kanonen lieber als Butter? Bevorzugen sie den Kriegskapitalismus? Wenn die Sozialausgaben gekürzt werden, um uns massiv zu bewaffnen, sollten die Bürger dann kein Mitspracherecht haben? ... Für Bildung und Gesundheit sei kein Geld da, heißt es einerseits, für Panzer, Kanonen und Flugzeuge werde man aber schon irgendwie Geld auftreiben, heißt es andererseits. Kredite in Hülle und Fülle. Steigende Zinssätze. Die Märkte werden ihre Arbeit tun. Sie verstehen nichts von sozialer Gerechtigkeit. Sie halten sie für einen entbehrlichen Luxus. Und da ist auch noch die Gefahr des Populismus. ... Die neue Politik muss von den Wählern gebilligt werden.“
Für einen offeneren Kontinent
Die Zeitenwende könnte auch anders aussehen, betont die Abgeordnete des Europaparlaments, María Eugenia Palop, in Eldiario.es:
„Die Welt ist unbeständig, unsicher, komplex und mehrdeutig. ... Kriegstreiberei beginnt den Ton anzugeben. ... Ein reaktives Modell ist erkennbar. Es gibt aber auch ein anderes, ein soziales, grünes und feministisches Modell, das Europa der Fürsorge. Dieses scheint jedoch eingefroren zu sein. ... Mit Russlands Einmarsch in die Ukraine, der Energiekrise und dem Siegeszug der extremen Rechten kam eine neue Wende. ... Die Erhöhung der Militärausgaben mag abschreckend wirken, aber sie ist nicht unbedingt effektiv. ... Die Zeitenwende könnte auch den Zusammenhalt fördern, Demokratie und weniger Armut bringen, ein offeneres Europa, uns wieder zum kulturellen Bezugspunkt machen, der wir immer waren.“
Aufrüstung statt Abrüstung birgt Risiken
Ein militärisch aufgerüstetes Europa darf seine blutige Geschichte nicht vergessen, schreibt O Jornal Económico:
„Wir Europäer haben manchmal schwierige nachbarschaftliche Beziehungen. Wir sind Partner, die Prinzipien, Probleme und eine gemeinsame Geschichte teilen. Gerade diese gemeinsame Geschichte mahnt zur Besonnenheit und zum Dialog. Die europäische Abrüstung ist nicht auf einen unbändigen europäischen Drang zum Pazifismus zurückzuführen – sie erklärt sich aus unserer brudermörderischen Versuchung, die durch die beiden großen Kriege bestätigt wurde. Jetzt, da wir wieder über Waffen verfügen, ist es wichtig, sich der Risiken dieser unvermeidlichen Entscheidung bewusst zu werden.“
Endlich koordinieren und führen
Der Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Petras Auštrevičius, gibt auf Lyrtas zu bedenken:
„Wenn schon heute klar ist, dass nicht alle EU-Mitgliedstaaten das Ziel von 3,5 Prozent des BIP für Verteidigung bis 2026 erreichen, sollten wir dieses Ziel nicht krampfhaft wiederholen, sondern realistischere Wege suchen, um Aufrüstung und Verteidigungsindustrie anzukurbeln. Wir könnten finanzielle Impulse geben, die über die Pandemiemaßnahmen hinausgehen – aber wir tun es nicht. Es fehlt auch die politische Diskussion, ob Teile der EU-Strukturfonds zur Stärkung der Verteidigung eingesetzt werden könnten. Worauf warten wir? ... Leider mangelt es der EU in dieser kritischen Phase nach wie vor an Entschlossenheit zur Koordination und Führung.“