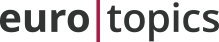Was folgt auf den Putsch in Gabun?
Die neuen Machthaber in Gabun unter General Brice Oligui Nguema haben eine Rückkehr zur Demokratie versprochen, ohne jedoch konkrete Schritte zu nennen. Sie hatten in dem rohstoffreichen zentralafrikanischen Land geputscht, nachdem der seit 2009 regierende Ali Bongo zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt worden war. Die Uno, die Afrikanische Union und Regierungen weltweit verurteilten den Putsch.
Zeit der Alleingänge ist vorbei
Frankreichs Einflusssphäre löst sich auf, meint Die Presse:
„Françafrique, die französischsprachigen Ex-Kolonien, schmilzt Frankreich unter der Sonne weg. … Unter der Ägide Frankreichs hat die EU viel an politischem Prestige und militärischer Macht investiert, um die Sahelstaaten vor dem islamischen Terrorismus zu schützen und vor dem Zerfall zu bewahren. Nun liefern sich die Generäle für einen kurzfristigen Vorteil den russischen Neoimperialisten aus, ohne dass sich die Sicherheitslage entscheidend verbessert hätte. … Höchste Zeit, dass die EU in einem ersten Schritt einen Afrika-Beauftragten ernennt. Eine Einigung über eine gemeinsame Strategie wäre der zweite. Die Zeit der Alleingänge ist vorbei. Diese Lektion sollten Frankreich und Macron gelernt haben.“
Ein Powerhouse mit Zukunft
Der Westen muss seine Beziehungen zu Afrika unbedingt verbessern, mahnt The Observer:
„Umfragen zeigen, dass junge Afrikaner nach echter Demokratie dürsten, aber viele von ihnen eine militärische Übernahme unterstützen, wenn alles andere fehlschlägt. ... Das Paradoxe ist, dass das dynamische, boomende, talentierte und ressourcenreiche Afrika trotz all seiner Probleme in vielerlei Hinsicht die Zukunft ist. Diese Aussicht sowie der zunehmenden Einfluss des autoritären Chinas und Russlands legen nahe, dass eine radikale Verbesserung der Beziehungen des Westens zum afrikanischen Powerhouse des 21. Jahrhunderts im besten Interesse aller wäre.“
Viel wird sich nicht ändern
Keskisuomalainen bezweifelt, dass die Putschisten für die Demokratie eintreten:
„Eine Machtübernahme wird stets mit hehren Zielen wie der Wiederherstellung der Demokratie gerechtfertigt. In Gabun war das leicht, denn das Land wird seit Jahrzehnten von einer autokratischen und korrupten Familiendynastie regiert. … Die Wahlen waren ein Spektakel der Bongo-Dynastie, aber wenn diese Herrschaft durch militärische Macht ersetzt wird, ändert sich nicht viel. … In Ländern wie Gabun führt der Reichtum an Ressourcen zu ungesunden Wirtschaftsstrukturen. ... Der Kolonialismus hat bei der Schaffung dieser Strukturen eine Rolle gespielt, aber Gabun hätte nach der Unabhängigkeit Jahrzehnte Zeit gehabt, die Situation zu verbessern, denn die Ressourcen dazu gab es.“
Wer die Waffen hat, hat die Macht
El País erkennt einen beschleunigten Ablösungsprozess vom Westen:
„Seit dem Beginn [mit dem Putsch] in Khartum gab es zehn Militäraufstände. Man muss bis in das Zeitalter der Putsche nach der Erlangung der Unabhängigkeit zurückgehen, um ein Phänomen dieses Ausmaßes zu finden. ... Der letzte, in Gabun, beendete eine Präsidentendynastie, die 1967 durch den französischen Präsidenten Charles de Gaulle an die Macht kam. ... Die Ablösung vom Westen scheint sich dort zu beschleunigen, wo Staaten schwach oder offen gescheitert sind und die Macht in die Hände derer fällt, die über Waffen und Unterstützung aus dem Ausland verfügen, sei es aus den Ölhauptstädten am Golf, Russland oder China. ... Diese Macht werden sie wohl kaum wieder abgeben.“
Im Wesentlichen bleibt alles beim Alten
Diena schreibt:
„Gabun gilt seit jeher als eines der stabilsten Länder der Region, daher kam der Sturz des Präsidenten für alle überraschend, insbesondere für Ali Bongo. Vor allem, weil der Anführer des Putsches sein Vertrauter war. ... Man kann das Geschehen im Wesentlichen weniger als Militärputsch denn als Umsturz im Hof bezeichnen. Die internationale Resonanz wird dementsprechend um ein Vielfaches geringer sein als bei anderen Staatsstreichen, zumal der General für seine proamerikanischen Ansichten bekannt ist. ... Oliguis Versprechen, bald demokratische Wahlen abzuhalten, klingt nicht überzeugend, und die Erfahrung zeigt, dass keine Militärmacht es jemals eilig hatte, solche Versprechen einzulösen.“
Es hängt an einer Person
El País fürchtet, dass der Umsturz keine Besserung bringt:
„Am Montag wird General Oligui Nguema als 'Präsident des Übergangs' vereidigt werden. ... Die Frage ist nun, ob er bleibt oder ob er sein Versprechen hält, Gabun zu einer gesunden Demokratie zu machen. ... Dass die Zukunft Gabuns von den Ambitionen eines einzelnen Mannes abhängt, ist kein gutes Zeichen. ... Die autoritären Exzesse einiger Regime haben gezeigt, dass es an Kontrollmechanismen mangelt. ... Daher der Überdruss einer Bevölkerung, die Putschisten zujubelt. Staatsstreiche sind verwerflich, aber das gilt auch für die tiefgreifenden Übel, die sie begünstigen.“
Frankreich muss sich neutral verhalten
Le Monde fordert Paris zu einem zurückhaltenderen Auftreten in Afrika auf, um weitere Umstürze zu verhindern:
„Es wird immer dringender, Haltung und Ton zu verändern, naheliegenderweise, indem man sich militärisch zurückzieht und eine strikt neutrale Position einnimmt, denn Frankreich drohen in Afrika bereits weitere Gefahren. In Kamerun, der Republik Kongo und Togo könnten andere unstürzbare und von Paris unterstützte Potentaten dasselbe Schicksal wie Ali Bongo erleiden.“
Westen muss echter Partner werden
Für die Süddeutsche Zeitung konfrontiert die jüngste Putschserie Europa und speziell Frankreich auf schmerzhafte Weise mit dem Scheitern ihrer Afrika-Politik:
„Es ist eine Lektion in Demut. Und ein Auftrag an die in Toledo versammelten EU-Außenminister, nicht die Symptome des Problems mit Sanktionen zu bekämpfen, sondern die Ursachen anzugehen. Will der Westen künftig als Partner in Afrika wahrgenommen werden, dem es um die Interessen der Menschen geht und nicht nur um den Zugang zu Rohstoffen, die Stationierung von Soldaten und die Abwehr von Flüchtlingen, dann hat er nur eine Wahl: Er muss dieser Partner werden.“
Europa ist in Afrika gescheitert
NRC-Kolumnist Michel Kerres sieht Zeichen einer geopolitischen Veränderung:
„Die Coups im Sahel und diese Woche in Gabun zeigen, dass es dem Westen, vor allem Europa, nicht gelungen ist, der Region Wohlstand und Sicherheit zu verschaffen - trotz aller schönen geopolitischen Ambitionen. Europa hat keine Antwort auf die giftige Kombination von Armut, Dschihadismus und antikolonialen (anti-französischen) Stimmungen. ... Die Brics-Gruppe wird möglicherweise langfristig eine Herausforderung.“
Eine zweite Dekolonialisierung
Avvenire analysiert:
„Guinea, Mali, Burkina Faso, Niger und jetzt Gabun bilden eine neue Gruppe afrikanischer Länder, die sich von Europa distanzieren und eine feindselige Haltung einnehmen, insbesondere gegenüber Frankreich. Man kann von einer zweiten Dekolonialisierung sprechen, da die des letzten Jahrhunderts durch eine neokoloniale Präsenz kontaminiert wurde, die zu aufdringlich war. … In diesen Jahrzehnten wurde keine echte Transformation der afrikanischen Wirtschaft in Gang gesetzt, sondern eine 'extraktive' Ausbeutung von Rohstoffen angewandt, die dem Kontinent nicht viel übrig ließ. Außerdem wird dem Westen vorgeworfen, trotz der von ihm vertretenen Werte korrupte und undemokratische Regierungen unterstützt zu haben.“
Mal ein verständlicher Umsturz
In der Serie von Putschen in Afrika in den vergangenen drei Jahren ist der in Gabun der nachvollziehbarste, schreibt die taz:
„In Mali, Guinea, Burkina Faso und zuletzt Niger wurden frei gewählte Präsidenten von ihrer Armee gestürzt, mit mehr oder weniger fadenscheinigen Begründungen. In Gabun wurde nun der amtierende Herrscher der mächtigsten und reichsten Familie des Landes, wenn nicht ganz Zentralafrikas, abgesetzt, nachdem diese Familie das Land seit nunmehr 56 Jahren regiert. Der Bongo-Clan ist eine zentrale Säule des korrupten neokolonialen französisch-afrikanischen Interessengeflechts, gegen das unzufriedene Jugendliche quer durch das ehemalige Kolonialreich auf die Straße gehen. Sein Sturz ist ein Putsch nicht bloß gegen einen Präsidenten, sondern gegen ein System.“
Ob wieder Putin dahintersteckt?
Der Putsch in Gabun ist ein weiterer Schlag gegen Frankreich, analysiert Večernji list:
„Wie im Niger hat Frankreich in Gabun eine Bergbaufirma namens Eramet, die angekündigt hat, ihre Arbeit in Gabun nach der Entwicklung der Lage dort niederzulegen. ... Eramet betreibt die einzige Manganproduktionsanlage des Landes und beschäftigt dort rund 8.000 Mitarbeiter. ... Analytiker sind davon überzeugt, dass dieser Putsch nach dem Niger ein weiterer schwerer Schlag für Frankreich ist, da es ein wahres Vermögen an Erzen aus diesen Ländern bezog. Obwohl die Situation noch undurchsichtig ist, würde sich niemand wundern, wenn der Putsch wie im Niger die Handschrift Wladimir Putins trägt, der die Konflikte mit den USA und der EU nach Afrika verlegt hat.“
Regierungen könnten auch einfach zurücktreten
Die Putschwelle in Afrika hat insbesondere demografische Ursachen, erläutert La Croix:
„Auf dem afrikanischen Kontinent drohen zahlreiche Regierungen aus dem Amt verjagt zu werden. Diese Welle erklärt sich größtenteils durch das niedrige Alter der Bevölkerungen, denen Zukunftsperspektiven fehlen. Die Regierenden müssen sich in diesem Kontext verantwortungsbewusst zeigen und den demokratischen Mechanismen vertrauen. Zur Sicherung der Entwicklung sind Stabilität, Transparenz und eine Kontinuität der Institutionen nötig. Ein Machtwechsel ist einem Putsch vorzuziehen.“
Neue Zurückhaltung in Paris
Tygodnik Powszechny schaut sich die Reaktion Frankreichs an:
„Mali, Niger, Tschad und Gabun gehörten zusammen mit der Elfenbeinküste und dem Senegal zu den wichtigsten Verbündeten Frankreichs in Afrika. Als es im Tschad zu einem Putsch kam, beschloss Frankreich, die Augen davor zu verschließen. Auf die Putsche in Mali, Burkina Faso und Niger reagierte es dann mit großer Empörung, wodurch es die Putschisten, die ihre Kriegsausbildung an französischen Akademien und Ausbildungsstätten erhalten hatten, gegen sich aufbrachte. ... Auf die Nachricht vom Putsch in Gabun haben die Franzosen nun sehr zurückhaltend reagiert, offenbar haben sie aus den schmerzhaften Erfahrungen in der Sahelzone gelernt.“