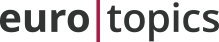Hat die Welt etwas aus der Finanzkrise gelernt?
Die Pleite der Investmentbank Lehman Brothers gilt Vielen als Katalysator der Finanzkrise. In der Folge brach vor zehn Jahren die Konjunktur weltweit ein, Staaten verschuldeten sich massiv und der Euro geriet in Schwierigkeiten. Doch Lehren wurden aus dem Desaster nicht gezogen, kritisieren Kommentatoren - wobei einige bezweifeln, dass dies überhaupt möglich wäre.
Ein verlorenes Jahrzehnt
Die Fehler unseres Wirtschaftssystems sind nicht behoben, fürchtet El País:
„Die Idee von der siegreichen Allianz aus Markt und Demokratie explodierte, als wir merkten, dass das ungehemmte Kapital in einem unkontrollierten Finanzsystem machte, was es wollte. Nach dem Fall der Mauer hatte sich die Logik vom Wohlstand für alle durchgesetzt. Aber sie verbarg eine trügerische Falle: Die soziale Frage war von der politischen Agenda verschwunden. ... In der traurigen Bilanz drohen die vergangenen zehn Jahre zum verlorenen Jahrzehnt zu werden. Denn es ist offensichtlich, dass der durch Lehman Brothers entfachte soziale Konflikt nicht dazu geführt hat, dass wir die wirtschaftlichen Bedingungen prüfen, die die Krise ermöglichten.“
Es begann nicht mit der Lehman-Pleite
Der Konkurs von Lehman Brothers war nicht der Auslöser der Finanzkrise, betont der Wirtschaftsexperte von Corriere del Ticino, Lino Terlizzi:
„Der Sturz von Lehman war Folge einer Krise, die bereits begonnen hatte. Auslöser waren die Immobilien. … An der Ansteckung anderer Finanz- und Wirtschaftszweige war dann die breite Verteilung der mit Immobilien verbundenen Risiken in Finanzprodukten schuld. Und die daraus resultierenden Kurseinbrüche an den Finanzmärkten, hatten negative Auswirkungen auf Banken, Unternehmen, Einkommen, Investitionen und Konsum. … Einen Unterschied zwischen Krise und Lehman-Pleite machen zu wollen, mag akademisch erscheinen, ist es aber nicht. Es ist wichtig, die wahren Wurzeln der Krise aufzuzeigen, umso mehr, wenn wir, wie oft behauptet wird, Lehren aus ihr ziehen wollen.“
Nach der Krise ist vor der Krise
Zehn Jahre nach der Lehman-Pleite wissen wir nicht, was die nächste Krise verhindern könnte, klagt Finanz und Wirtschaft:
„Möglicherweise ist jede Krise so anders als alle anderen zuvor, dass sich Einsichten und Erfahrungen über Krisen und ihre Folgen sowieso überhaupt gar nicht von einer Dekade auf die nächste übertragen lassen. Das dürfte dann ganz besonders der Fall sein, wenn eine Krise derart fundamentale Veränderungen und disruptive Entwicklungen verursacht, wie es bei der Finanzmarktkrise war. Dann lautet die finale Erkenntnis des 15. September 2008, dass sich aus Krisen lediglich lernen lässt, dass man aus ihnen nur lernen kann, dass offenbar 'nach der letzten Krise vor der nächsten Krise' ist, aber nichts darüber, was die nächste Krise verhindern könnte.“
Systemwechsel ist bisher ausgeblieben
Mit gemischten Gefühlen, blickt Jutarnji list auf die Lehman-Pleite und deren Auswirkungen:
„Die positive Seite der Geschichte, die mit Lehman begann und - sagen wir - mit dem Auslaufen des Kreditprogramms für Griechenland endete, ist, dass man sehr viel vorsichtiger geworden ist. Neue Finanzregeln in den USA und der EU geben den Banken erheblich weniger Freiraum, um im Trüben zu fischen. Die große Finanzkrise hinterlässt aber noch eine unbeantwortete Frage: Ist die Zeit reif für eine Weltordnung, die nicht vor allem 'finanzzentriert' ist? Die populistischen Bewegungen, deren Aufstieg wir gerade beobachten, sind nämlich das direkte Resultat eines (bisher noch ruhigen) Aufstands derer, die sich in solch einem System unterjocht fühlen.“
Frustration nährt den Illiberalismus
Noch besorgter klingt das Fazit von Le Monde:
„Die amerikanischen Banken waren noch nie mächtiger, die Börsen vermerken ein Rekordhoch nach dem anderen. Die Reichen waren noch nie reicher. ... Das ist aber nicht das Entscheidende. Nach zehn Jahren des wirtschaftlichen Stillstands und der Sparpolitik haben sich die, die am schwersten an der Krise zu tragen haben, von den Eliten abgewandt und sich in die Arme derer geworfen, die versprechen, endlich die etablierte Ordnung zu stürzen. 2008 hat Zweifel geweckt an den Vorzügen der liberalen Demokratien, an der Effizienz der Grenzöffnung und daran, ob die Politik die Ungleichheit wirklich vermindern will. Seither speist die Frustration identitäre Forderungen, der Illiberalismus nimmt zu, die Globalisierung ist auf dem Rückzug. Das Vertrauen in das System ist zerbrochen.“
Neue Krise wäre noch gefährlicher
Gerade Europa wird sich eine neue Krise nicht noch einmal leisten können, warnt der Tagesspiegel:
„Anders als vor zehn Jahren hätten die Notenbanker ihr diesmal kaum noch etwas entgegenzusetzen. Der Leitzins der Euro-Zone liegt bereits bei null Prozent: Ihn noch weiter zu senken, ist zwar theoretisch möglich. Nur hätte das krasse Folgen, etwa die, dass auch Kleinsparer von den Banken mit Minuszinsen bestraft würden. Politisch ist das mehr als heikel. Mit anderen Worten: Eine neue Krise ist möglich, doch es fehlen die Instrumente, um sie zu bekämpfen. Und diesmal kann niemand mehr überrascht tun und sagen, es habe ihn keiner gewarnt.“
Nicht auf Protektionismus setzen
Dagens Nyheter stellt entschieden fest, dass Nationalismus keinen Schutz vor einer neuen Finanzkrise bietet:
„Die Finanzkrise hat das Vertrauen der Menschen in das politische und wirtschaftliche Establishment geschwächt. Wenn Experten und Institutionen nicht erfolgreich sind, was können wir dann tun? Die Flüchtlingskrise 2015 hat die Zweifel genährt und Populisten den Weg bereitet. Marktwirtschaft und liberale Weltordnung waren in den letzten zehn Jahren schwach. Gleichzeitig aber war die internationale Zusammenarbeit ein wichtiger Bestandteil der Medizin gegen die Finanzkrise. Nationalismus und Protektionismus sind kein Impfstoff gegen eine neue Krankheit, sondern Gift.“
Finanzmärkte noch immer instabil
Ohne grundlegende Neuordnung des Wirtschaftssystems ist eine erneute Finanzkrise nur eine Frage der Zeit, warnt The Guardian:
„Die Risiken werden heruntergespielt. Da heißt es dann, dass so etwas [wie 2008] nicht wieder passieren könne, da die Regulierungsbehörden nun aufmerksamer seien und die Banker mehr Eigenkapital als Sicherheitspolster gegen mögliche Fehler vorhalten müssten. Doch schon ein flüchtiger Blick auf die Märkte offenbart, wie überhitzt diese sind, wie anfällig für plötzliche Veränderungen, wie trügerisch ihre viel gerühmte Liquidität ist - und wie viel jene gewinnen können, die bereit sind, etwas zu wagen. ... Wir müssen dringend die Risiken minimieren und unsere Wirtschaft umgestalten.“
Europa agiert schwerfällig in der Krise
Die Trägheit der europäischen Entscheidungen machen die EU anfälliger als etwa die USA, konstatiert El Mundo:
„Dank ihrer agilen Institutionen der Verwaltung und der Wirtschaft konnten sich die USA vor zehn Jahren ziemlich schnell aus der Krise befreien. Wesentlich langsamer gingen die Dinge in der EU vonstatten, wo Griechenland erst kürzlich aus dem Rettungsschirm entlassen wurde. In Brüssel wurden viele Maßnahmen ergriffen, die zu einer monumentalen Umstrukturierung des Bankensektors führten sowie zu internationalen Abkommen zur Stärkung des Euro. ... Aber man ist noch weit davon entfernt, die notwendige Finanzunion zu vollenden. Und eine populistische und europafeindliche Welle hält den Kontinent im Moment davon ab, jene Mechanismen zu stärken, die uns dabei helfen würden, auf eine künftige Rezession besser vorbereitet zu sein.“
US-Politik hat kein Interesse an Regulierung
Kongressabgeordnete und Lobbyisten halten jene Aufsichtsbehörden, die die Finanzmärkte kontrollieren sollen, bewusst schwach, klagt The Washington Post:
„Die wichtigste Lektion der Krise ist nicht, dass Märkte fehlbar sind. Das wusste bereits jeder aufmerksame Beobachter. Die entscheidende Lehre ist, dass die wichtigsten gesetzlichen Möglichkeiten der Regulierung von zersplitterten Regierungsapparaten und raubgierigen Lobbyisten behindert werden. Gemeint sind jene Beschränkungen, für die sich der angeblich so regulierungsfeindliche [frühere Chef der Fed] Greenspan stark gemacht hatte. Auch heute noch hat das US-Finanzsystem mehrere Aufsichtsorgane, die verschiedenen Kongressausschüssen rechenschaftspflichtig sind, weil dies den Angeordneten zusätzliche Möglichkeiten bietet, von Wahlkampfspenden zu profitieren.“
Die kleinen Leute fühlen sich betrogen
Auch wenn sich das Wirtschaftswachstum inzwischen wieder eingerenkt hat, sind die Folgen der Krise weltweit zu spüren, erinnert La Vanguardia:
„Die globale Staatsverschuldung hat sich mehr als verdoppelt - auf 60 Billionen US-Dollar; ebenso die privaten Schulden - auf 66 Billionen Dollar. Das birgt das permanente Risiko eines neuen Kollapses. ... Banken und Konzerne erwirtschaften seit Jahren wieder Gewinne, aber die Überwindung der Krise wurde in den meisten Staaten nationalisiert, also auf den Steuerzahler abgewälzt. Der Ärger darüber und das Gefühl des kollektiven Betrugs, das in der Mittel- und Arbeiterschicht herrscht, erklären die Veränderungen in der Politik: das Erstarken populistischer Bewegungen sowohl auf der linken als auch auf der extrem rechten Seite des Spektrums sowie das Wiederaufleben des Nationalismus.“
Finanzkrise brachte Trump und den Brexit
Auch Financial Times wundert sich nicht, dass sich in vielen Ländern große Teile der Bevölkerung von den Eliten abgewendet haben:
„Die Kosten wurden zum größten Teil jenen auferlegt, die diese am wenigsten tragen konnten. Bei der finanziellen Konsolidierung wurde viel stärker auf die Kürzung von Staatsausgaben als auf die Erhöhung von Steuern gesetzt. Im Falle Großbritanniens betrug das Verhältnis unter dem damaligen Finanzminister George Osborne 80:20. … Die 'hart arbeitende Klasse', die von Politikern so gerne umschwärmt wird, wenn diese Stimmen brauchen, war das Opfer. ... Wer wundert sich da noch, dass weiße US-Arbeiter, die Jobs verloren, die früher als sicher galten, nun Donald Trump unterstützen? Es ist auch nicht verwunderlich, dass vergleichbare Bevölkerungsschichten für den Brexit waren.“
Linke verpasste historische Chance
The Guardian beklagt, dass das neoliberale kapitalistische System, das die Finanzkrise erst ermöglicht hat, nahezu unverändert fortbesteht:
„Der Bankensektor wurde nie zerschlagen. Die Pläne für eine Finanztransaktionssteuer verstauben in den Schubladen. Politiker spielten mit dem Gedanken eines neuen Klimapakts – und vergaßen diesen schnell wieder. Es gab nie eine echte Abkehr von der vorherrschenden Lehrmeinung, nur ein kurzes Innehalten, das schnell wieder beiseitegeschoben wurde. Die brutale Wahrheit ist, dass die Linke ihre Chance hatte, diese aber verpasste.“
In Italien droht der nächste Absturz
In Italien könnte die nächste Finanzkrise ausbrechen, warnt Die Presse:
„Steigen die Marktzinsen wegen mangelnder Haushaltsdisziplin weiter, wird die Refinanzierung wegen der Kurzfristigkeit der Schuld schnell deutlich teurer. Schon jetzt liegt die Zinsenlast bei 40 Mrd. Euro. Experten haben neulich vorgerechnet, dass die Schuldenlast durch steigende Zinsen selbst bei gutem Wachstum in den nächsten fünf Jahren auf gut 150 Prozent des BIPs gehen könnte. Also fast schon in griechische Dimensionen - und mitten hinein in ein realistisches Ausfallszenario. Die Regierung bereitet die Bevölkerung jedenfalls auf absehbare Schwierigkeiten vor: Mehrere Regierungsmitglieder haben zuletzt vor 'Attacken' der Finanzmärkte auf das Land gewarnt. Schuld sind also vorbeugend einmal die anderen.“
Das Schlimmste kommt erst noch
Kathimerini glaubt ebenso, dass sich neues Unheil zusammenbraut:
„In den letzten zehn Jahren haben viele Dinge, die wir im entwickelten Westen als Fakt betrachteten, ihre Gültigkeit verloren, während andere, die als undenkbar galten, Teil der Realität wurden. … Und das Erschreckende ist, dass wir erst am Anfang stehen. Der Wettbewerb mit den aufstrebenden asiatischen Kräften wird sich verstärken. Die Technologien der Vierten Industriellen Revolution werden riesige, schwer zu bewältigende Änderungen für Alltag und Arbeit bringen. Im Vergleich zu ihren Nachfolgern werden die Demagogen von heute einst als rational und vorsichtig gelten. Die nächsten zehn Jahre können viel schlimmer werden.“